Ausgestorbene Eifelberufe
Von
Dr. Viktor Baur - aus Eifel-Kalender 1955
Man könnte viele Vergleiche darüber anstellen, wie sich im Zeitraum von fünfzig Jahren das äußere Bild der Eifel, ihrer Landschaft, ihrer Wirtschaft und ihrer Menschen gewandelt hat. Mich haben dabei Eifler Menschentum und Menschenschicksal mitsamt der soziologischen Gestaltung dieses alten Agrarlandes immer ganz besonders gefesselt, und im Verweilen bei alten Erinnerungen wendet sich meine nachstehende Betrachtung einigen Alteifeler Berufen zu, die heute fast restlos ausgestorben sind.
Mit den Scherenschleifern möchte ich beginnen. Es waren freundliche Leute eines friedfertigen Gewerbes, die nicht nur Scheren, sondern auch jedwede andere Schneidewerkzeuge schliffen und wieder gebrauchsfähig machten. Der frühere Scherenschleifer schleppte seinen ganzen Gewerbebetrieb auf dem Rücken über Berg und Tal der Eifel. Seine „Maschinerie“ bestand zwar nur aus einem dreischenkligen Bockgestell aus Holz, aber daneben mußte er noch mindestens zwei bis drei recht gewichtige Schleifsteine, meist aus Kyllsandstein gefertigt, mitschleppen, und das war für ihn schon eine recht ansehnliche Last.
Von Frühling bis Herbst zog er durch das Land. In den Bauerndörfern fand er freilich nicht viel Arbeit. Die Eifelbauern schliffen, wie heute noch, ihre Brot- und Schlachtmesser selber auf dem handgetriebenen Sandschleifstein, der auch im kleinsten Hof irgendwo in der Ecke stand. Auch ihre Sicheln und Sensen schärften und dengelten sie so genau wie kein anderer tun konnte. Und gar ihre „Kneip“, das Universaltaschenmesser jedes ehrsamen Eifelbauern, gaben sie schon gar nicht einem daherfahrenden Scherenschleifer, das schliffen sie selber mit Sorgfalt und Bedacht für die verschiedensten ihrer „Kneip“ zugedachten Zwecke.
Die eigentliche Domäne des Scherenschleifers waren daher die Marktflecken, Klein- und Kreisstädtchen der Eifel. Gewichtig pflanzte er sich hier mit seinem Schleifgerät am Rand der belebten Hauptstraße auf. Eine begeistere Kinderschar umstand derweils seine kleine Schleiffabrik, aus der sprühend die Funken stoben. In der damals noch durch keinen Autolärm und kein Verkehrsgehaste gestörten Stille des Eifelfleckens klang das Surren des Schleifsteines auf der Straße wie eine nicht alltägliche, aber dennoch vertraute Melodie, schnell öffneten sich Türen und Fenster der Bürgerhäuser, und unaufgefordert brachten Hausfrauen und Köchinnen, Mägde und Männer dem Scherenschleifer heraus, was alles zu schleifen und schärfen war. Viel Arbeit gab es für ihn, und war sie zu Ende, so schulterte er sein Gerät und trug es hundert Meter aufwärts auf die Hauptstraße, wo sich dasselbe Spiel wiederholte. Schleifen und Surren, Bewegung und Kinderjauchzen. Und weiter und weiter zog er über die Eifelberge dahin.
Ein wenig tiefer auf der sozialen Rangstufe stand der Kesselflicker. Im Gegensatz zum Scherenschleifer kam er fast nie allein, sondern stets mit „Gefolge“. Dieses bestand aus einem meist erbärmlichen, von einem dürren Gaul gezogenen Wohnwagen, in dem die ganze Familie ihre Bleibe und an Regentagen auch ihre Arbeitsstätte hatte. Anders als die Scherenschleifer hatten die Kesselflicker ihre Domäne im Eifeler Bauerndorf. Was gab es da nicht alles zu flicken und zu löten! Kochkessel und Töpfe, Pfannen und Eisen, Viehtröge und Dachrinnen! Im Verlaufe der Jahre verschleißt sich unendlich viel im Bauernhof.
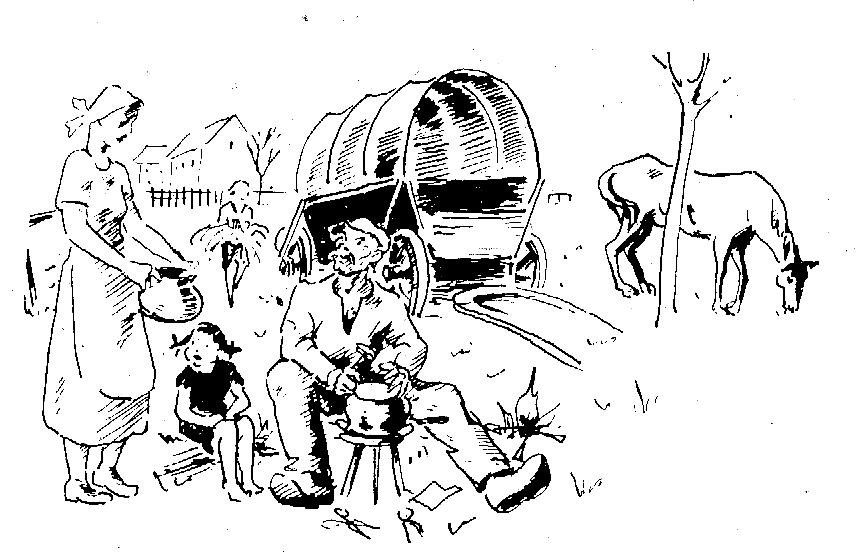
Kesselflicker
- Skizze von Jupp Heinz
Die Eifeler Kesselflicker kamen freilich mit ihren Wagen selten ins Dorf. Sie schlugen ihre Lagerstätte achtungsvoll am Rand der Dörfer oder Kleinstädte auf. Auf sie und ihren Unterkunftsplätzen hielten, ich weiß nicht, auf Grund welcher Gesetzesbestimmungen, die preußischen Gendarmen vieler Eifeler Kreisstädte ein wachsames Auge. Auch im Eifeler Volksmund wurde das Gewerbe der Kesselflicker vielfach auf die gleiche Stufe gestellt wie das der herumstreunenden Zigeuner. Vielleicht zu Unrecht, denn auch unter den Kesselflickern gab es ehrliche und redsame Leute, die ihr hartes Brot im Umherziehen verdienen mußten, wenn sich auch ihr magerer, abgetriebener Wagengaul von den Bauernäckern ernährte.
War dann vor dem Dorf ein geeigneter Stammplatz erkoren, so gingen Frau und Kinder von Haus zu Haus und schleppten all das Geschirr, was zu flicken und zu löten war, zur Arbeitsstätte. Zwei, drei Tage dauerte meist die Arbeit des Kesselflickers, und war kein wunder Kessel im Dorf mehr aufzutreiben, dann gings mit dem klapprigen Wohnwagen, der die ganze Habe dieses ärmlichen Gewerbes umfaßte, über die Eifel von Dorf zu Dorf den ganzen Sommer über.
Es gab aber auch gehobenere Wandergewerbeberufe in der Eifel. An erster Stelle steht hier der Postillon. Vor fünfzig Jahren war er nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der damaligen Eifeler Reiseromantik, sondern ein noch wichtigeres Glied in der Eifeler Verkehrswirtschaft. Das Eisenbahnnetz war damals noch recht dürftig ausgebaut, die Querverbindungen zwischen den Hauptbahnstrecken Köln - Trier und Trier - Koblenz und den wenigen davon abzweigenden Binnenstrecken, wurden nur durch Postkutschenlinien hergestellt. Im Auftrage der Postbehörde unterstand der Postkutschenverkehr den Posthaltereien, die, an besonders wichtigen Kreuzungspunkten gelegen, meist größere Bauern- und Fuhrhaltebetriebe mit genügend leistungsfähigem Pferdematerial waren. Sie gehörten damals zu den wirtschaftlich wichtigsten und aufstrebenden Orten, wie etwa Kaisersesch, Lutzerath, Münstermaifeld, Kelberg, Daun, Manderscheid, Kornelimünster, Kempenich, Gemünd, Simmerath und anderen.
Ein Eifeler Postillon hatte in diesem Betrieb keine leichten Beruf. Im glühenden Sommer ohne jeden Schutz eingepreßt, in seine enge Uniform und seinem bewehrten Helm, im Winter auf seinem Bock den Sturm, Frost und Schneetreiben preisgegeben, war er voll verantwortlich für seine Passagiere und den wertvollen Inhalt des Postsackes. Im Winter war er dazu oft größeren Widerwärtigkeiten und Gefahren ausgesetzt. Mein Vater, der um die Jahrhundertwende Postverwalter in Daun war, hat mir häufig davon erzählt, wie oft der abends von Gerolstein nach Daun fahrende Postwagen nachts auf der eiskalten Höhe von Dockweiler im Schnee stecken blieb. Da mußte der brave Postillon den Postsack schultern und durch den Schnee zum nächsten Dorf waten, dort das Postamt in Daun anrufen, das wieder die Posthalterei alarmierte und dann mit einem leichten Schlitten der bedrängten Postkutsche entgegenfuhr. Wenn es not tat, und das kam häufiger vor, mußten sogar die Bauern aus dem Schlaf geweckt werden, um die eingeschneite Postkutsche wieder freizuschaufeln.
Im Sommer konnte es dafür aber auch um so schöner für den Postillon sein. Da konnte man das Posthorn erklingen lassen, da gabs auch oft ein kräftiges Trinkgeld von den Beamten und Reisenden, da fühlte man sich, wenn man durch die Dörfer fuhr, so recht erhaben auf dem hochthronenden Bock, wenn die Mädchen an den Strecken keck emporschauten und macher frohe Winkegruß hin- und herging. - Das alles ist heute dahin. Vor wenigen Jahren hat man oben in der Vulkaneifel den letzten hochbetagten Eifelpostillon begraben. Es war fast wie ein kleines Staatsbegräbnis! Man hat ihm aus vielen Trompeten ein Leiblied geblasen. Aber es war doch nicht so das rechte Leiblied, weil der Abstand zu der alten Postillonzeit schon so groß war, man auch die alten Postillonweisen nicht mehr kannte. Heute fahren moderne Postillons in großen Autobussen durch das Eifelland. Ihre Arbeit ist wahrlich nicht weniger leicht und verantwortungsvoll als die der alten Eifelpostillone, wohl aber prosaischer und nüchterner.
Wie der Postillon brachten auch die Eifelmusikanten eine freundliche und romantische Note in das gleichmäßige Geschehen und den geruhsamen Alltag des dörflichen und kleinstädtischen Lebens in der Eifel. Man kann fast von einer besonderen Gilde des früheren Eifeler Musikantentums sprechen. Sie kamen etwa alle drei bis vier Wochen in die Kleinstädtchen und Dörfer der Eifel und erledigten an einem Tage etwa vier bis sechs Orte, in denen sie ihr Standkonzert gaben. Die Trupps bestanden aus drei bis zehn Mann. Es waren nie dieselben Trupps, sondern immer wieder andere, als ob sie unter sich ihre Strecke vereinbart hätten. Gewöhnlich trugen sie eine blaue Schirmmütze, um die Besonderheit ihres Berufes auch nach außen hin zu kennzeichnen.
Die Eifeler Musikanten hatten ausschließlich Blasinstrumente; Trompete, Horn und Klarinette waren die wichtigsten Dinge ihrer Musikantenkunst. Kamen sie ins Dorf, so waren sie sofort von einem Schwarm fröhlicher Jugend umringt. Feierlich postierten sie sich an einem besonders verkehrsreichen Platz des Ortes, und dann ging es los. Mit einem Marsch fing es gewöhnlich an. Dann war mit einem Mal das stille Dorf oder die verträumte Kleinstadt wie verwandelt. Die Türen und Fenster öffneten sich, viele traten ins Freie und nahe an den Trupp heran. In den Amtsstuben legten die Schreiber ihren Federhalter weg und eilten zum Fenster. In den Bürgerhäusern wurden die dunklen Vorhänge zurückgezogen und die Läden und Fenster geöffnet, damit möglichst viel von dem fröhlichen Musizieren hereindränge. Kam ein Bauer mit seinem Fuhrwerk die Straße herauf, so hielt er wohl mit dem Ochsen vor der Gruppe an, kramate in seinen Taschen rum, ob er noch einen Kupfernen bei sich trage. - Dem Eröffnungsmarsch folgten andere flotte Weisen, Polka, Rheinländer, und im Verlauf des etwa halbstündigen Platzkonzertes, das nachher noch in einem anderen Ortsteil wiederholt wurde, rannen auch die Münzen immer dichter in der Mütze zusammen. Ein Marsch noch zum Abschluß, dann zogen die Musikanten die Landstraße weiter, und der nüchterne Alltag spannte wieder seinen Bogen um das stille Eifeldorf, das für eine kurze Weile hinausgehoben worden war über sein Dasein.
Den letzten Musikantentrupp erlebte ich in der Eifel ein paar Wochen nach Ausbruch des ersten Weltkrieges. Es war gerade ein großer Sieg gewesen im Westen, und darauf waren die Melodien der Musikanten abgestellt. An den Straßen standen gedrängt die Menschen und spendeten Beifall. Und es floß von Münzen in die Mütze! - Seit diesem Tage habe ich nie mehr einen Eifeler Musikantentrupp gesehen. Sie sind vom Winde und den Zeiten verweht, ausgestorben! Schade drum!
Ein wichtiger Alteifeler Beruf war früher der Hausierer und Händler. Er ist heute noch keineswegs ausgestorben, aber seine Tätigkeit vollzieht sich in ganz anderen Bahnen als früher. Heute sind auch die Händler weitgehend motorisiert, ob sich aber im Zeichen dieser Modernisierung solche ausgesprochenen Originaltypen herausbilden wie früher, erscheint sehr zweifelhaft. Der frühere Eifeler Hausierer war Universalhändler. Er hatte von allem etwas in seinem Hausiersack: Haus- und Küchengeräte, Hosenträger und Schuhriemen, Wolle, Textilien und anderes mehr. Der heutige Eifelhausierer ist Spezialist geworden. Er führt entweder nur Bürstenwaren oder Fußmatten, Wolle, Strümpfe oder derlei Dinge.
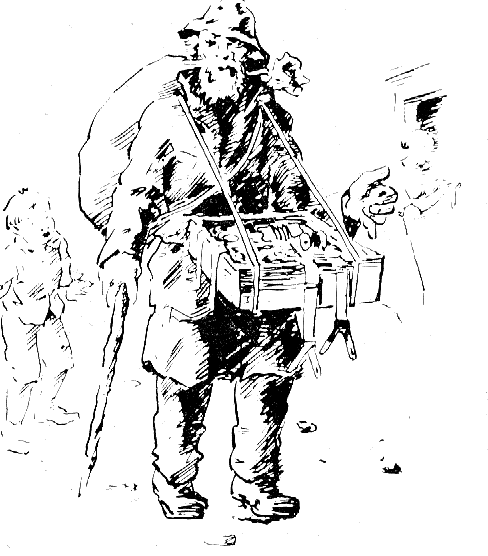
Hausierer
- Skizze von Jupp Heinz
Aus meiner Jugend sind mir zahlreiche Hausierer bekannt, die in regelmäßiger Folge die Eifelorte besuchten und von Haus zu Haus ihre mannigfachen Waren feilboten. Es waren viele Originale darunter, aber der König von ihnen blieb doch der „Hornickel“. Er stammte aus einem armen Dorf im „Hinterbüsch“ im Kreis Daun. Die Landstraße war seine Welt. Mit was er eigentlich hausieren ging, war nie restlos zu erfahren. Er schleppte stets einen unergründlichen Sack mit allerhand Zeug mit sich. Noch undurchsichtiger war seine Kleidung und Erscheinung. Er war wie in Lumpen und Sackleinen gehüllt, und mit seinem struppigen Bart und einem tief in den Kopf gezogenen alten Hut war er der Kinderschreck in den Eifeldörfern. Man hielt sich darum stets in achtungsvoller Entfernung von ihm, was aber nicht hindern konnte, daß, sobald er sich dem Dorf näherte, es straßauf, straßab aus Kindermund schallte: „Der Hornickel kütt“.
Zwei, drei Jahrzehnte hindurch war er in einem großen Teil der Eifel bestbekannt. Vor fünfzig Jahren wurde von ihm eine Postkarte verkauft, die sein Bild trug, auf der ungefähr zu lesen stand:
„Von Andernach bis
Gerolstein,
Da ist die ganze Eifel mein,
Von Gerolstein bis
Trier,
Gehört sie auch noch mir!“
Damit war das Wirkungsfeld von Hornickel räumlich genau umrissen. Mit den zunehmenden Jahren wurde in den damals stramm preußisch regierten Eifeler Kreisstädchen das Auftreten Hornickels fast zur Landplage. Die Gendarmen nahmen sich seiner an und sorgten dafür, daß er schnell wieder abgeschoben wurde. Ich selbst habe gesehen, wie der Hornickel sehr zum Leidwesen von uns Kindern mit Gewalt aus der kleinen Kreisstadt hinausbugsiert wurde. Das alles hinderte, wie erzählt wird, den damals leutseligen Dauner Landrat, Herrn von Ehrenberg, nicht, den fast „staatsgefährlichen“ Hornickel einmal zu einer Flasche Wein und einer Zigarre einzuladen. Es soll eine ergötzliche Unterredung gewesen sein, von der nichts weiter verlautet als die Tatsache, daß Hornickel dabei die landrätliche Zigarre im Munde zerkaut und dann in seine schwarzirdene Pfeife gestopft habe.